Glaubst du noch an eine bessere Zukunft?
Ich verstehe, wenn nicht. Klimakrise, Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise, Energiekrise und Krieg. Krise ist das Wort des Jahrhunderts – obwohl erst ein Viertel davon vorbei ist. Unser Leben wird von Krisen diktiert. Eine bessere Zukunft ist auch nicht realistisch. Wenn der Mensch den Klimawandel weiter im gleichen Maße anheizt, klettert die Erderwärmung 2100 auf zu 4,7 Grad, schätzt das Umweltbundesamt. Bei diesem scheinbar so geringen Temperaturanstieg ändern sich die Umweltbedingungen so drastisch, dass die Gesellschaft, wie wir sie kennen, zusammenbrechen würde. Weltweit fehlt es an Zusammenarbeit und Motivation, die Klimaziele einzuhalten. China, das 29 Prozent aller Treibhausgase weltweit emittiert, baut bis 2030 noch neue Kohlekraftwerke. Es fördert so eine der emissionsstärksten Industriezweige und macht das 1,5 Grad Ziel fast unmöglich. US-Präsident Trump leugnet den Klimawandel. „Nächstes Jahr wird’s wieder kälter, ihr werdet schon sehen“, meinte er im Januar bei einer Pressekonferenz.
Bereits 2024 lag die Durchschnittstemperatur im Vergleich zum vorindustriellen Niveau bei knapp 1,6 Grad. Deutschland und der Europäischen Union sind, trotz aller Motivation und Green-Deals, die Hände gebunden. Die EU stößt nur sieben Prozent der weltweiten Treibhausgase aus. Auch wenn wir in Europa unsere Emissionen bis 2030 auf null reduzieren, ein für die EU vergleichsweise realistisches Projekt, wäre die Welt bei weitem nicht gerettet. Krise bleibt wahrscheinlich das Wort des Jahrhunderts.
Wenn du aber doch an eine bessere Zukunft glaubst, geht es dir wie siebzig Prozent der Ukrainer. Diese geben Hoffnung als vorherrschendes Gefühl neben Leid und Kriegsangst an, zeigte der ukrainische Soziologe Holowacha in einer empirischen Studie. Auch ich glaube an eine bessere Zukunft. Die Menschheit hat so viel Unglaubliches erreicht, wir können die meisten Krankheiten heilen, einen Großteil der Menschen hat jeden Tag Essen auf dem Tisch, wir können inzwischen sogar fliegen. Wenn wir als Menschheit zusammenhalten und es gemeinsam probieren, dann muss doch eine bessere Zukunft möglich sein, oder? Es muss doch eine bessere Welt geben, nach der wir streben können!
Die Welt der Utopien
Ähnlich dachte sich das auch Sir Thomas More im sechzehnten Jahrhundert, als er sein Buch „Utopia“ schrieb. Er glaubt an eine Möglichkeit, die Welt zu verbessern. In der fiktiven Geschichte erzählt ein Reisender von einer Insel. Auf dieser Insel führen die Menschen ein „perfektes“ Leben. Gold ist dort ein minderwertiges Metall und auch die Ärmsten führen ein würdiges Leben. Sein Begriff „Utopia“ hat sich durchgesetzt und wird heute noch verwendet, um die Vision einer besseren Welt zu beschreiben. Das Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Nicht-Ort“, also ein Ort, der in Wirklichkeit gar nicht existiert oder existieren kann. Ein besserer Ort.
Utopien entstehen, wenn sich Menschen eine bessere Welt wünschen. Drängende Probleme führen bei uns zu Träumen, in denen diese vollends gelöst sind. Diese Träume formen gesammelt unsere Utopie. Krisen und Utopien sind also eng verwandt. Ein Beispiel: Marx‘ Utopie des Kommunismus. Auch hier spielt die Krise eine zentrale Rolle. Die Industrialisierung erfüllte nicht das Versprechen, allen Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Im Gegenteil: Sie zog einen Großteil der Bevölkerung in Abhängigkeiten und Unterdrückung. Marx schaffte den Gegenentwurf: Eine Welt, in der es keine zentrale Macht mehr gibt, in der alle alles besitzen und alle Menschen frei und gleich sind.
Die Kraft der Utopien
Utopien haben Schlagkraft. Sie bieten die Möglichkeit, existierende, gefestigte Gesellschaftsstrukturen zu hinterfragen und neue, bessere Systeme zu entwickeln. Marx’ Idee des Kommunismus führte zu Protesten, Aufständen und Revolutionen gegen ein fest verankertes System. Der Kommunismus oder sein kleiner Bruder, der Sozialismus, prägen die Welt bis heute. Seine Utopie veränderte die Weltgeschichte. Das Ende der Sklaverei ist ein weiteres Beispiel für erfolgreiche Utopien. Sie wurde für Jahrhunderte als unerlässlicher Teil des amerikanischen Wirtschaftssystems gesehen. Frederick Douglas wurde 1818 in Maryland als Sklave geboren. Später befreite er sich, zog nach New York und wurde Aktivist. Gemeinsam mit anderen Freiheitskämpfern schaffte er es, nach dem Sezessionskrieg die Sklaverei in den USA verbieten zu lassen.

Martin Luther King und seine Vision des Endes der Rassentrennung ist ein weiteres schönes Beispiel für Utopien. Seine gänsehauterregende Rede „I have a dream“ und die damit gemeinte Utopie der klassen- und rassenlosen Gesellschaft gilt auch heute noch als eines der besten Beispiele für erfolgreiche Protestbewegungen. Heutzutage ist Rassentrennung in den meisten Teilen der Welt eine Sache für die Geschichtsbücher – auch diese Utopie hat die Gesellschaft verändert. Der Wandel durch Utopien ist fast so alt wie die Politik selbst. Selbstverständlich wirkende Systeme können durch Utopien aufgebrochen werden.
Die großen Utopien zerbrechen
Große, waghalsige, ja teils auch unrealistische Zukunftsvorstellungen waren lange Zeit Teil fast aller politischen Richtungen. Kommunismus, Kapitalismus, Faschismus, Monarchismus haben alle eine gewisse Utopie hinter sich. Doch mit der Zeit kollabierten diese Utopien. Hunger nahm dem Volk das Vertrauen in den König. Der von Gott erwählte Herrscher dachte eher an sich selbst, als an die hungernde Bevölkerung. Die Monarchie verlor ihre Legitimität. Die Sowjetunion zerfiel und brachte den Menschen mehr Leid als Glück. Damit starb in den meisten Teilen der Welt der große Traum des Kommunismus.
Kommunismus und Faschismus sind gute Beispiele, wie Utopien auch ins Negative verändern können. Utopien haben Schlagkraft in alle Richtungen. Welche Veränderungen sie bringen, ob sie Gruppen ausgrenzen oder eingrenzen, ob sie Hass auslösen oder mindern, kommt auf die Utopie an. Die NS-Diktatur hat unglaublich viele utopische Strukturen und Errungenschaften zerstört, wie die deutsche Freiheit und Demokratie. Utopien können wahnsinniges Leid auslösen, statt zu retten. Mit ihrer Utopie unterdrückten und töteten Hitler und Mussolini Millionen Menschen. Große Utopien bergen große Gefahren, sie können zur Dystopie für alle werden.
Die hartnäckigste große Utopie bis heute ist wohl die des unendlichen Wachstums. Der Glaube, dass es einfach immer so weiter gehen kann. Dass die Ressourcen der Erde unendlich sind und wir sie einfach immer weiter ausbeuten können. Am Ende stirbt sogar diese Utopie. Spätestens seit der Fridays-for-Future-Bewegung wird immer mehr Menschen klar, dass die Zukunft mit unserer jetzigen Wirtschaftsweise noch mehr Krisen und Leid bringen wird. Auch den Frieden hat uns der Kapitalismus am Ende nicht gebracht. Die großen Utopien sterben, es denken immer weniger Menschen hoffnungsvoll utopisch. Auch die Politik scheint Utopien vergessen zu haben. Politiker*innen sitzen in ihren Büros in Stuttgart, Berlin oder Brüssel. Sie streiten sich in den Parlamenten über die Gegenwart und Vergangenheit. Doch die Zukunft ist kaum Thema. Wovon sie träumen, weiß man nicht. Wer das erfahren will, darf sich durch zweihundert Seiten Parteiprogramm fressen. Wie viel und ob überhaupt Utopie in der Politik bleibt, kann ich nicht sagen.
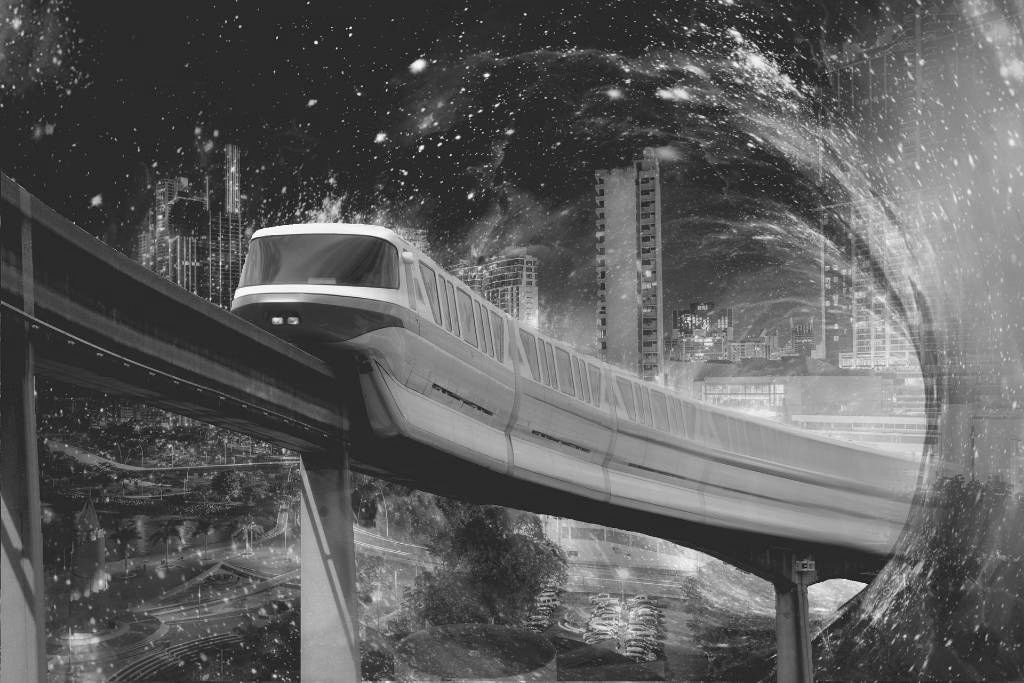
Wir brauchen Utopien!
Krisen, Krisen, Krisen. Wir sind wieder am Anfang. Wir wissen zwar jetzt, dass Utopien Schlagkraft haben, wir wissen aber auch, dass Utopisch denken aus der Mode geraten ist. Als Gesellschaft scheinen wir festzustecken, alle Krisen wirken hoffnungslos. „Die großen Ölfirmen können wir nicht stoppen“, denken wir uns, oder „Menschen wie Putin gewinnen am Ende immer“. Meiner Meinung nach ist genau dieses Denken der Fehler!
Und so komme ich wieder zu meiner Aussage zurück: Trotz des Todes aller großen Utopien habe ich eine Utopie, habe ich weiterhin Hoffnung in die Zukunft. Es existiert eine Welt, in der es allen besser geht, in der wir friedlich und demokratisch zusammenleben und es keinen Klimawandel mehr gibt. Wenn gerade nicht in der Realität, dann zumindest in meinem Kopf. Und ich hoffe, dass ich mit einem solchen Gedanken nicht alleine bin. Wir haben das Träumen wohl hoffentlich nicht ganz verlernt.
Utopien können selbstverständlich wirkende Systeme sprengen. Sie erlauben uns, eine geträumte, bessere Zukunft zu erreichen. Das ist unsere Chance aus dem Loch, in dem wir stecken, herauszukommen!
Realistische, Werte geleitete Utopien
Wenn wir nur von fernen Utopien träumen, die in unserer Lebzeit nicht mehr erreichbar sind, trifft uns wahrscheinlich die Resignation. In einem Raumschiff zum Mars fliegen werde ich wohl nicht mehr. Was wir brauchen, sind realistische Utopien. Wir müssen uns überlegen, was wir für Probleme haben und wie wir diese konkret lösen können. Einem solchen Plan gibt uns die nötige Motivation und Hoffnung. Durch das Sich-Vorstellen gehen wir den Schritt, der uns von der Lethargie in die Handlung, von der Verzweiflung in die Hoffnung katapultieren kann.
Was wir aber überhaupt nicht brauchen können, sind Diktaturen-Utopien wie den NS-Faschismus. Heute sind wir schlauer als vor achtzig Jahren. Wir wissen, wie viel Leid diese Art von Utopie bringt. Wir müssen es heute schaffen, uns von diesen Utopien fernzuhalten. Erich Kästner schreib in seinem Buch „Der Tägliche Kram“ über die Zeit nach der NS-Diktatur: „Die Feuer der Schuld und des Leides sollten alles, was unwesentlich ist, zu Asche verbrannt haben. Dann wäre, was geschah, nicht ohne Sinn gewesen. Wer nichts mehr auf der Welt besitzt, weiß am ehesten, was er wirklich braucht. Wem nichts mehr den Blick verstellt, der blickt weiter als die anderen. Bis hinüber zu den Hauptsachen.“ Nach dem Krieg ist in Deutschland eine bis heute relativ gesunde Demokratie entstanden. Wir Deutschen wussten, was wesentlich ist. Demokratie, Menschenrechte; Werte bedeuteten uns viel. Utopien ohne diese Werte führen meist zum Völkermord und der totalen Zerstörung. Wir müssen aus den Fehlern von damals lernen. Dann war das, was geschah, nicht ohne Sinn gewesen. Wir brauchen nicht nur konkrete Utopien, wir brauchen Utopien mit starken Werten, die aus der Vergangenheit gelernt haben.
Lasst unsere Utopien wieder die schwachen, kranken Wände der Systeme einreisen. Lasst sie ein neues, besseres Haus bauen. Lasst uns gemeinsam wieder träumen.
Ob so auch die Politiker denken? Fragen wir einfach nach!
Wie soll ihrer Meinung nach ein utopisches und realistisches Europa 2060 aussehen? In dem Jahr, in dem alle Klimaprognosen enden, alle Ziele erreicht sein müssten. In dem die Welt ein großes Fragezeichen ist.
Ob sie darauf eine Antwort haben?
Das findet ihr im Podcast Utopia heraus, hier auf REDAK!
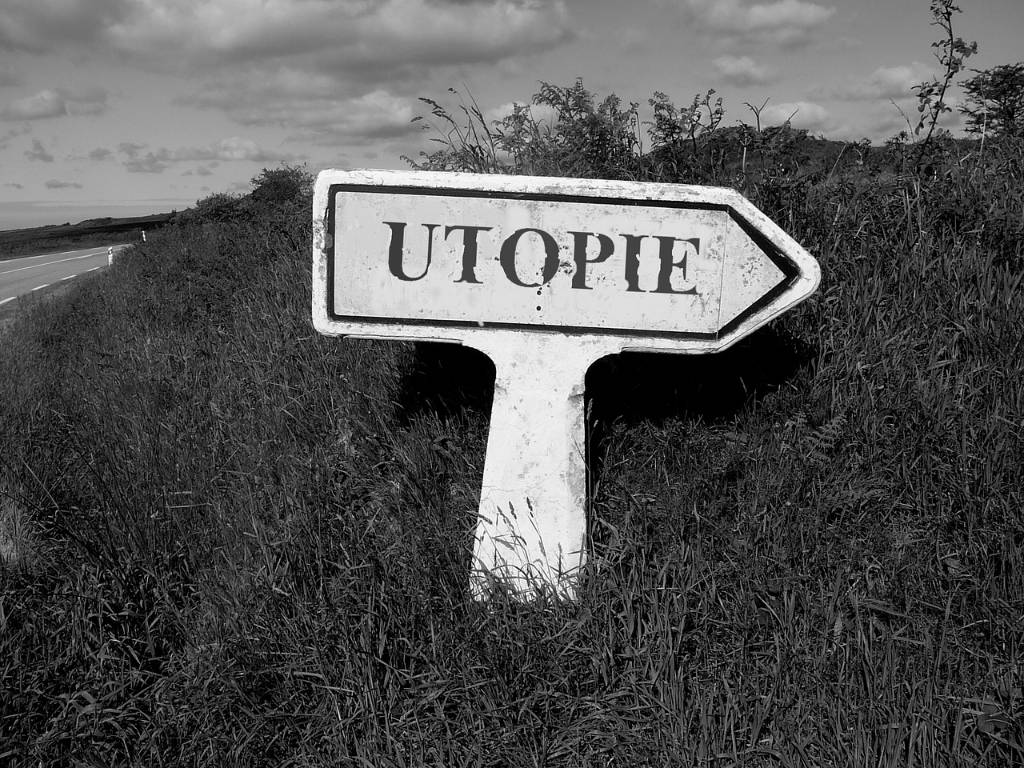
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.